Bechers späte Einsicht - DDR-Dichter
und Kulturminister lobte 1953 Stalin und distanzierte sich schon bald von ihm

Das von Fritz Cremer geschaffene Denkmal des
Dichters steht seit 1960 im Bürgerpark in Berlin-Pankow. Der Schlüsselsatz in
der Becher-Hymne, in den frühen 1950er Jahren noch auf Plakaten propagiert,
wurde während der Honecker-Ära nicht mehr geduldet.
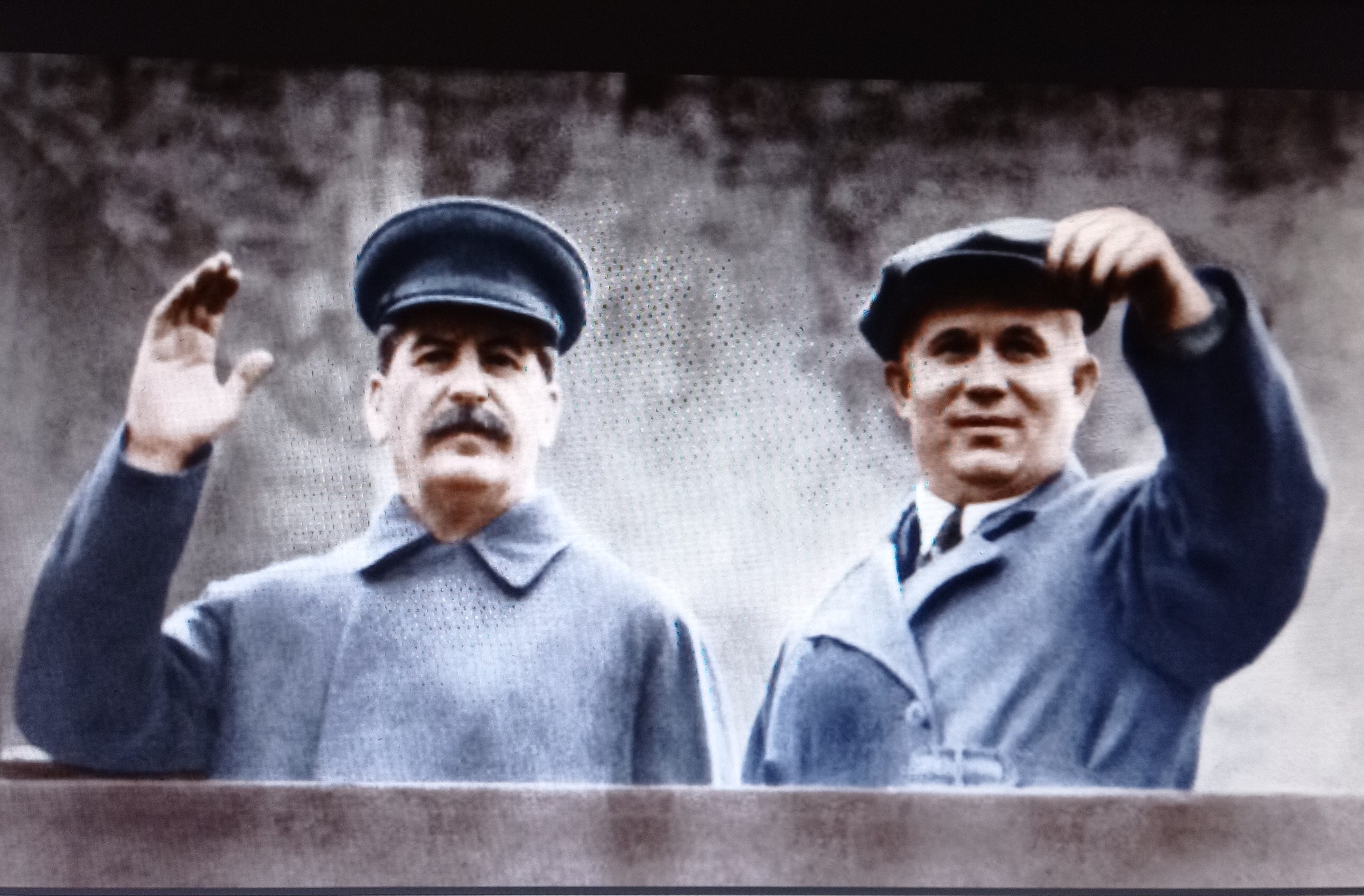
Nikita Chruschtschow, einem der engsten
Vertrauten von Stalin, fiel 1956 die Abrechnung mit dem „Genossen Gott“ zu.
Seine Geheimrede blieb nicht lange geheim. SED-Chef Walter Ulbricht, hier sich
mit Stalin und Mao Tse-tung bei einer Kundgebung selbst beklatschend,
unterdrückte ohne Erfolg die 1956 in Moskau verkündeten Enthüllungen.

Die ostdeutsche Propaganda lobte Stalin über den
grünen Klee und schrieb ihm übersinnliche, ja gottähnliche Eigenschaften zu.
Sein Tod 1953 wurde tagelang betrauert. Als 1956 auf dem XX. Parteitag der
KPdSU in vorsichtiger Form Stalins Verbrechen angesprochen wurde, herrschte in
der DDR eisiges Schweigen. Der Stalinist Walter Ulbricht und Genossen bekamen
es nicht fertig, ernsthaft ihrem Idol abzuschwören.

Wo Stalin ist, da sind Frieden, Glück, Wohlstand
und Zukunft, trommelte die kommunistische Propaganda. Eine in England gedruckte
Spottschrift zeigt in der Art des „Struwwelpeter“, wie Stalin Nazibonzen im
Tintenfass versenkt.
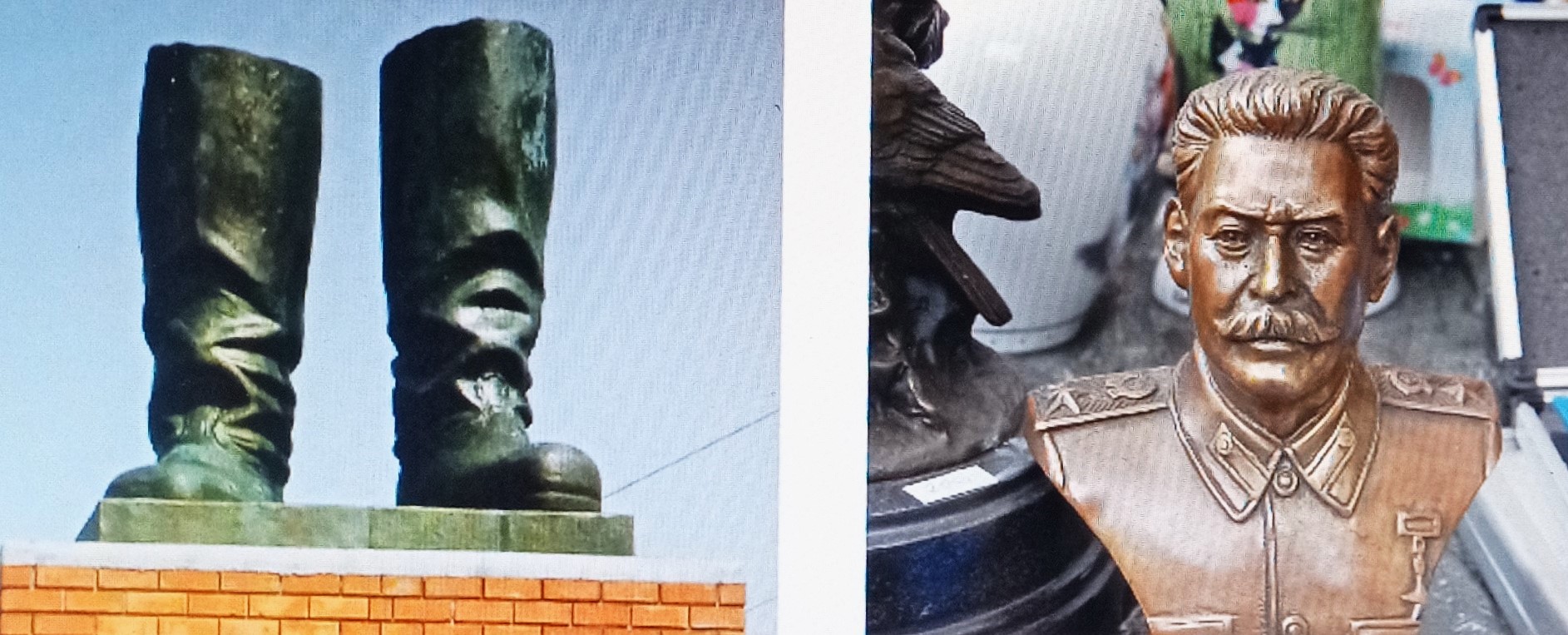
In der Sowjetunion wurden 1956 und danach überall
Stalin-Bilder abgehängt. Vom riesigen Stalin-Denkmal in Budapest blieben nur
die Stiefel übrig, die man wie zum Hohn auf einen Sockel gestellt hat.
Stalinbüsten und andere Andenken an eine finstere Zeit sind auf manchen
Trödelmärkten zu haben.

Die Wut der Ungarn über Stalins Verbrechen und die
seiner Getreuen entlud sich in Ungarn in einem Aufstand in Ungarn, der 1956 von
sowjetischen Panzern niedergewalzt wurde und viele Tote forderte.
Fotos/Repros: Caspar
Der Dichter Johannes R. Becher (1891-1958) ist uns
heute, wenn überhaupt, nur nur noch als Autor der DDR-Hymne mit der
Anfangszeile „Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt“ bekannt. Das
Lied wurde zum erstenmal in Berlin am 6. November 1949 anlässlich einer
Festveranstaltung zum 32. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution gesungen
und soll vom Publikum ergriffen und begeistert aufgenommen worden sein. Der vom
SED-Politibüro genehmigte Text kennzeichnete treffend die Aufbruchstimmung nach
dem Zweiten Weltkrieg. Aber schon der nächste Satz „Lasst und dir zum Guten
dienen, Deutschland einig Vaterland“ war Jahre später angesichts der
Abgrenzungspolitik in der Honecker-Ära zwischen 1971 und 1989 politisch nicht
mehr erwünscht. Deshalb hat man die Hymne nicht mehr gesungen, sondern nur noch
vom Orchester gespielt. 1989/90 wurde die Zeile „Deutschland einig Vaterland“
von Bürgerrechtlern skandiert und alsbald am 3. Oktober 1990 durch den Beitritt
der DDR zur Bundesrepublik Deutschland ersehnte Realität.
Johannes R. Becher hatte in seinem Moskauer Exil während der Nazizeit
zahlreiche Deutschland-Dichtungen verfasst und war als Kulturpolitiker in der
DDR mitverantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der von der SED
gelenkten Kulturpolitik und der mit ihr verbundenen staatlichen Zensur. Für die
im Westen „Ruinenwalzer“ genannte Hymne schrieb Becher mehrere Textentwürfe,
die nach eigenem Bekunden von jeder Gemüsefrau verstanden werden sollte.
Zunächst war der Komponist Otmar Gerster mit der Vertonung beauftragt. Doch
dann traf Becher in Warschau Hanns Eisler, der eine Melodie vortrug, die dem
Dichter gefiel. In Ost-Berlin fand bald darauf in Anwesenheit von SED- und
FDJ-Funktionären ein Wettstreit zwischen beiden Komponisten statt, den Eisler
gewann. Bei Gersters Vertonung hatte man hymnisches Pathos vermisst. Becher und
Eisler wurden für ihr gemeinsames Werk 1950 mit dem Nationalpreis, der höchsten
DDR-Auszeichnung für Künstler und Wissenschaftler, ausgezeichnet. In der
Bundesrepublik wurde behauptet, Eisler habe mit den ersten Noten den Song von
Peter Kreuder „Good bye, Jonny!“ plagiiert, den der Schauspieler Hans Albers in
dem deutschen Abenteuerfilm „Wasser für Canitoga“ von 1939 gesungen hatte. Der
Streit verlief im Sande und ist heute kaum noch bekannt.
Becher und andere flinke Reimeschmiede nahmen
den Tod des sowjetischen Staats- und Parteiführers Josef Stalin am 5. März 1953
zum Anlass, ihn als weisen Führer des Weltproletariats, siegreichen Feldherrn
über Hitlerdeutschland, Erbauer des Kommunismus auf einem Sechstel der Erde,
wie man damals sagte, und treusorgenden Landesvater zu verherrlichen. Wenn man
heute Bechers langes Gedicht „Danksagung“ liest und die Lieder hört, die damals
bei politischen Veranstaltungen und Festivals Stalin zu Ehren gesungen wurden,
muss man sehr an sich halten um nicht zu lachen. Sie waren aber ernst, ja
todernst gemeint, und wer sich damals über die Elogen lustig machte, bekam es
mit der Sowjetmacht und ihren ostdeutschen Ablegern zu tun.
Was einmal gedruckt ist, kann nicht mehr getilgt
werden, es kursiert und bleibt präsent. Und so mögen sich einige um Stalins
literarische Vergöttlichung bemühte Schreiber schon bald ihrer Worte geschämt
haben, nachdem ihr großes Vorbild nach seiner Entlarvung 1956 auf dem XX.
Parteitag der KPdSU in Moskau durch Nikita Chruschtschow nicht mehr en vogue
war. Becher beschrieb 1953, wie Stalin mit Marx und Engels durch Stralsund geht
und in Rostock die Traktoren überprüft, wie er die Betriebe an der Ruhr besucht
und mit Bauern spricht, wie sich in Dresden die Bilder einer Galerie vor ihm
verneigen. „Mit Lenin sitzt er abends auf der Bank, / Ernst Thälmann setzt sich
nieder zu den beiden. / „Und eine Ziehharmonika singt Dank, / Da lächeln sie,
selbst dankbar und bescheiden“. Stalin, der Lenin unserer Zeit, wie man sagte,
ist überall, auch in Westdeutschland, das eines Tages von seinen
imperialistischen Unterdrückern befreit sein wird, lautet die Botschaft dieses
„Danksagung“ genannten Becher-Gedichts, das mit dieser Strophe endet: „Und kein
Gebirge setzt ihm eine Schranke, / Kein Feind ist stark genug, ihm zu
widerstehn / Dem Mann, der Stalin heißt, denn sein Gedanke / Wird Tat, und
Stalins Wille wird geschehn“. In schaler Erinnerung bleibt Bechers Vorstellung,
dass die Fluten des Rheins und der Kölner Dom von Stalin erzählen. „Und durch
den Schwarzwald wandert seine Güte / Und winkt zu sich heran ein scheues Reh“.
In diesem Stil schwangen sich auch andere von
der Partei ermunterte und mit Wohlwollen honorierte Lyriker wie Stephan Hermlin
und Kuba zu schwülstigen Höhenflügen auf. In einer seinerzeit intonierten Hymne
findet sich dieser Refrain „Stalin führte uns zu Glück und Frieden, /
Unbeirrbar wie der Sonne Flut. / Langes Leben sei Dir noch beschieden: /
Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.“ Louis Fürnberg schrieb in seinem Lied über die Partei, die immer
recht hat: „Der das Leben beleidigt, / Ist dumm oder schlecht. / Wer die
Menschheit verteidigt, / Hat immer recht. / So, aus Leninschem Geist, / Wächst,
von Stalin geschweißt, Die Partei - die Partei - die Partei.“ Den Hinweis auf
Stalin wollte man nach 1956 nicht stehen lassen, weshalb die Zeile „So, aus Leninschem Geist, wächst zusammengeschweißt, die
Partei, die Partei, die Partei.“ Wie schnelle Dichter waren auch
bildende Künstler dabei, das Bildnis ihres Übervaters zu verbreiten. Ihre
Gemälde, Denkmäler und Büsten landeten schon bald auf dem Müllhaufen der Geschichte.
Zwar wurde in der Sowjetunion mehr oder weniger
deutlich über den „Personenkult“ um Stalin gesprochen, mit dem seine Verbrechen
und Fehleinschätzungen umschrieben wurden. Aber eine klare Abrechnung war erst
im Zeichen der nach 1985 von Michail Gorbatschow ausgerufenen Politik von
„Glasnost und Perestroika“ (Offenheit und Umbau) möglich. In der DDR hüllte
sich die Parteiführung in Schweigen, sprach von Entgleisungen und von
Personenkult rund um den bis dahin hymnisch verehrten Genossen Stalin. Erst
1961 entschloss sie sich, Stalinstadt in Eisenhüttenstadt umzubenennen, während
die Berliner Stalinallee den Namen Karl-Marx-Allee erhielt und das dort vor
einer Sporthalle aufgestellte Stalindenkmal abgebaut wurde. Angeblich sollen
aus der Bronze Figuren für den Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde gegossen
worden sein.
Zu Bechers Ehrenrettung sei gesagt, dass er
gegen Ende seines Lebens tief in seinem Innersten mit Stalin und seinen eigenen
Genossen haderte. Vom SED-Chef Walter Ulbricht zum Staatsdichter und größten
deutschen Dichter der Gegenwart hochstilisiert, war dem am 11. Oktober 1958
Kulturminister kein „schweigendes Begräbnis“ auf dem Dorotheenstädtischen
Friedhof in Berlin vergönnt, wie er es gewollt hatte, sondern eine prunkvolle,
sich über Tage hinziehende Totenehrung, durch die sich Ulbricht als sein angeblich
bester Freund in Szene setzte. Zehn Jahre nach dem von Becher befürchteten
„Leichenfirlefanz und Mummenschanz“ wurde die Verfilmung der DEFA von Bechers
autobiographisch gefärbtem Roman „Abschied“ aus den Kinos genommen worden, weil
er nicht ins Bild passte, das sich die SED- und Staatsführung von „ihrem“ Hans
machte.
Bei zahlreichen nationalen und internationalen
Sportereignissen sowie anderen offiziellen Gelegenheiten war die Hymne nach der
Ablösung von Walter Ulbricht als Partei- und Staatschef nur noch ohne jenen von
der DDR-Führung als nicht mehr zeitgemäß empfundenen Text zu hören. Angesichts
der von Erich Honecker praktizierten Abgrenzungspolitik konnte man unmöglich
die Vision von „Deutschland einig Vaterland“ singen. Einen neuen Wortlaut in
Auftrag zu geben oder eine ganz neue, den veränderten Gegebenheiten Rechnung
tragende Hymne schaffen zu lassen, hat sich das Honecker-Regime offenbar nicht
getraut.
Der Kommunist und Dichter Johannes R. Becher, der in
der Sowjetunion Stalins „Großen Terror“ überlebt hatte , kam nach dem Zweiten
Weltkrieg aus dem Moskauer Exil in die Sowjetische Besatzungszone
beziehungsweise ab 1949 der DDR, wo er eine steile politische Karriere
startete. Er kam zu der Erkenntnis, dass er in Stalin einem falschen „Gott“
gehuldigt hatte, war aber nicht so mutig, dies auch öffentlich und in klaren
Worten zu sagen. Er strich zwei Absätze aus den ihm zur Korrektur vorliegenden
Buches „Bemühungen - Reden und Aufsätze“, in dem er sein Bedauern über eigene
Verfehlungen in Bezug auf Stalin ausdrückte. Als Kulturminister dürfte Becher
den Wortlaut der Rede von Chruschtschow über den Diktator und Massenmörder
gekannt haben. Mit Blick auf die 1956 in der Sowjetunion begonnene
Entstalinisierung schrieb er: „Gewisse Ereignisse in letzter Zeit haben mir ein
Thema wiedergegeben, auf das zu verzichten mir nicht nur schwer gewesen wäre ,
sondern dessen Verzicht mir auch als Lebens Lüge hätte vorgeworfen werden
können , und darum bin ich dankbar, dass diese Ereignisse eingetroffen sind,
trotzdem...“ Für Becher war es ein Grundirrtum seines Lebens, dass der
Sozialismus die menschliche Tragödie beendet. Er erkannte einerseits darin eine
gleichsam kleinbürgerliche spießerhafte, idyllisch Auffassung vom Sozialismus
und andererseits das nur allzu beflissene Bestreben, das sozialistische
Experiment mit einer Apologetik zu umgeben, also mit allen Mitteln zu
verteidigen.
1956 hatte Becher den vierten Band seiner „Bemühungen“
dem Aufbau Verlag Berlin übergeben, kurze Zeit nach Chruschtschows Enthüllungen
über die Verbrechen von Stalin. Bevor das Buch ein Jahr später gedruckt wurde,
strich Becher sieben Absätze aus den Fahnenkorrekturen. Die Streichungen
erschienen erst 1980 in der Zeitschrift „Sinn und Form“ (Heft 3/1980). Dass sie
in der Ära Honecker veröffentlicht wurden, ist erstaunlich und hat vielleicht
mit einer kurz Zeit der Liberalisierung der Zensur zu tun. In seinem
ungewöhnlichen Bekenntnis rang Becher um jedes Wort. In ihm sei der Konflikt
offen ausgebrochen, in dem er sich, „nur wenigen Menschen erkennbar, jahrelang
verzehrte“. Er müsse nicht mehr schweigen, und er brauche nicht das Gefühl zu
haben, weiterhin mitschuldig zu werden dadurch, dass er schweigt. Es gelte, nur
noch die Sprache zu finden , um all das Ungeheuerliche beredt zu machen und
wiedergutzumachen, was er, Becher, durch Schweigen mitverschuldet hat. Er wolle
nicht weiter Schuld auf sich laden, aber jene unendliche Schulden wenigstens zu
einem winzigen Teil abzahlen und sich auch nicht durch irgendeine Hintertür aus
dem Leben hinausschwindeln wie jene, die schon immer „dagegen waren“, womit der
Personenkult und um Stalin und seine Verbrechen gemeint waren. Es ist so, als
habe mit dem Sozialismus die menschliche Tragödie in einer neuen, ganz und gar
bisher ungeahnten und von uns noch nicht zu
übersehbaren Form ihren Anfang genommen, schrieb Becher weiter. Das schlug
allen Prognosen und Verheißungen der „führenden Genossen“ ins Gesicht, die eine
Welt des Wohlstandes, des Friedens, der Freiheit und des Glücks an die Wand
malten und von ihren Untertanen verlangte, dass man ihren Worten ohne Murren
folgt.
Becher Bewertungen konnten der SED- und Staatsführung nicht behagen. Sie
durften nicht an die Öffentlichkeit dringen. Der Dichter und Politiker wusste,
wie „Abweichler“ behandelt werden, weshalb er seine verklausulierte, aber für
alle verständliche Kritik aus dem fast fertigen Buch entfernte, aber irgendwo
ablegte, so dass man sie später fand. Die SED- und Staatsführung vergoss 1958
Krokodilstränen an seinem Grab, obwohl sie wusste, dass der „teure Tote“ zu
Erkenntnissen gekommen war, die, wenn sie ans Tageslicht gelangt wären, einen
Schatten auf das strahlende Bild werfen würden, das von ihm in „linientreuen“
Nachrufen und posthumen Ehrungen gemalt wurde. Dieser Schatten hätte auch ihr
Bild als Vorkämpfer des wissenschaftlichen Sozialismus verdunkelt. Bechers späte Einsicht steht in den Geschichtsbüchern nur als
Fußnote, aber immerhin hat es sie gegeben, wenn auch sehr vorsichtig formuliert
und ohne Nennung irgendwelcher Politikernamen. Andere waren mutiger und wurden,
sofern die Kommunisten Zugriff auf sie hatten, verfolgt und bestraft.
28. August